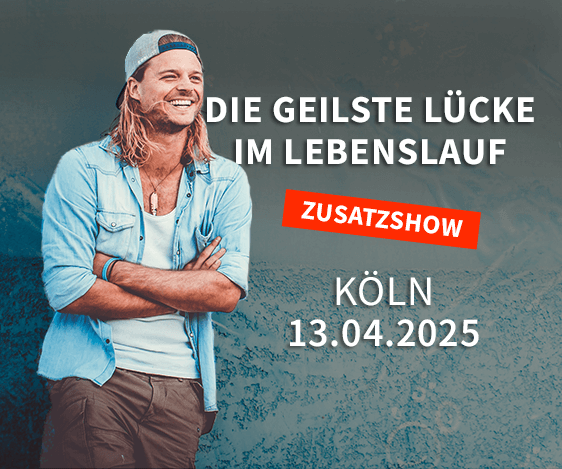Seenomaden
Wir suchen die weißen Flecken auf der Seekarte!“
Im Januar 2017 sind die beiden Weltumsegler Doris Renolder & Wolfgang Slanec mit ihrer Reise-Reportage „Frei wie der Wind“ in Düsseldorf und Köln zu Gast.
Für die aktuelle Ausgabe der GRENZGANG-News haben wir mit den Seenomaden über Merino-Unterwäsche, schüchterne Grönländer und den unvergänglichen Reiz des Abenteuers gesprochen:
Eure letzte Reise ging durch den hohen Norden. Was hat euch in die Kälte gezogen?
Doris Renoldner: Das klingt vielleicht komisch, aber wir wollten noch einmal ein Abenteuer erleben, uns ins Unbekannte wagen. Noch haben wir den Biss und die Energie, die dafür nötig sind. Südsee, das geht auch, wenn wir älter sind.
Was reizt euch an Grönland?
Wolfgang Slanec: Karibik, Passatroute, das ist Urlaubssegeln. Aber Urlaub ist nicht unser Ding, wir wollen reisen, etwas erleben und entdecken. Wenn du auf der üblichen Route unterwegs bist, eingebettet in den Strom der anderen Yachten, gelingt dir genau das nicht. Wir suchen die weißen Flecken auf der Seekarte, das reizt uns. Renoldner: Ich hatte bestimmte Bilder von Grönland im Kopf und wollte wissen, ob sie der Realität entsprechen.
Tun sie das?
Renoldner: Ja, absolut. Ich habe noch nie so viele Eisberge gesehen. Die Küste ist wild und karg, es gibt keine Bäume, nur Felsen und arktische Tundra.

Wie seid ihr mit der Kälte zurecht gekommen?
Slanec: Unsere Nomad ist ja eigentlich ein Badeboot und nicht für die Bedingungen im hohen Norden ausgerichtet. Der Rumpf besteht aus Aluminium und ist überhaupt nicht isoliert, deshalb kriecht die Kälte ungehindert in den Salon und in die Kajüten. Unser Dieselofen an Bord ist permanent gelaufen. Beim Segeln können wir allerdings nicht heizen, weil der Ofen bei Lage extrem qualmt. Das wäre zu gefährlich.
Renoldner: Dementsprechend haben wir unterwegs gefroren. An Deck war es saukalt und drinnen konnten wir uns auch nicht aufwärmen. Die Wärmflasche war meine ständige Begleiterin, sei es in der Koje oder in der Nierengegend unter dem Segelanzug.
Was hat euch die meisten Sorgen bereitet?
Renoldner: In den Tropen ist das Wasser dein Freund, hier ist es dein Feind. Es hat 2 bis 3 Grad – darin überlebt man nicht lange, man darf also auf keinen Fall über Bord gehen. Bei Landgängen haben wir immer ein Survival-Paket mitgenommen, mit UKW-Gerät, Satellitentelefon, Müsliriegel, Wasser, Messer, Biwaksack und so weiter. Wir waren ja so gut wie immer die einzige Yacht weit und breit. Wenn du nach einer Wanderung zurückkommst und das Dingi ist nicht mehr da, weggeschwemmt oder vom Eisbären zerfetzt, kommst du nicht mehr zum Schiff. Schwimmen ist definitiv nicht möglich. Du erfrierst mit Blick auf deine Yacht – keine schöne Vorstellung.

Bevor ihr den Bug nach Norden gerichtet habt, wart ihr ja drei Jahre lang in wärmeren Gefilden unterwegs, dort, wo es auch viele andere Blauwassersegler gibt. Wenn ihr diese Reise mit den Weltumsegelungen, die ihr vor rund 25 bzw. zehn Jahren unternommen habt, vergleicht: Wie hat sich die Szene eurer Einschätzung nach entwickelt?
Slanec: Die Segler hocken viel mehr vor dem Computer. In den 1990ern sind sie noch die meiste Zeit im Cockpit gesessen, man hat geplaudert, ist auf einen Drink vorbei gekommen. Heute hauen alle unter Deck in die Tasten. E-Mails schreiben, Blog befüllen. Das hat einen riesigen Stellenwert bekommen. Für mich ist das befremdlich. Das sind Manager auf Auszeit, die ihre Büro-Attitüden mit an Bord nehmen.
Renoldner: Auffällig ist, dass die Yachten immer größer werden und die Yachties über mehr Geld verfügen als früher. Eine Weltumsegelung ist heute oft ein minutiös durchgeplantes, zeitlich begrenztes Projekt. Früher war es eine Form der Lebensführung.
Was hat sich bei euch geändert?
Renoldner: Wir sind keine Ausnahme. Auch unser Boot ist auch größer geworden, auch wir haben mehr Geld zur Verfügung und wir sind technisch besser ausgerüstet. Auf der zweiten Weltumsegelung haben wir noch unsere Kreuze auf der Seekarte gemacht, jetzt passiert im Grunde alles auf dem Plotter. Eigentlich schade. Wir nutzen natürlich auch alle Möglichkeiten um eine gute Wetterprognose zu bekommen.
Slanec: In Patagonien, also 2002/2003, hatten wir nur ein Wetterfax, das für zwölf Stunden gültig war, zur Verfügung. Den Rest mussten wir uns aus den vorliegenden Informationen erschließen. Das war natürlich viel schwieriger. Andererseits haben wir dadurch ein Gespür dafür bekommen, wie sich die Dinge entwickeln. Das fehlt vielen „digitalisiserten“ Yachties, glaube ich.
Wie sieht es auf persönlicher Ebene aus? Bemerkt ihr an euch selbst Veränderungen?
Renoldner: Ich glaube, wir sind geduldiger geworden, vielleicht auch ängstlicher. Zumindest ich. Ich habe zu viele Geschichten gehört, was alles passieren kann.